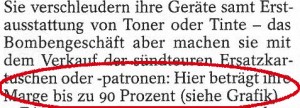Nun nimmt sich also sogar die ehrwürdige New York Times der ZDF-Fernsehshow „Wetten, dass …“ an. Nicholas Kulish, der Berlin-Korrespondent der bedeutendsten Tageszeitung der Welt, fragt in einem längeren Artikel im Onlineangebot der NYT, was die Show über das deutsche Fernsehen im speziellen und über die Kultur in Deutschland im allgemeinen aussagt. Die altmodische Anmutung, alberne Spiele und ein Moderator, der eher wie ein guterzogener Schuljunge daher kommt: Altbekannte Kritiken, die letztlich nur konstatieren lassen, dass es auch im Westen nichts Neues über das in die Jahre gekommene Schlachtschiff deutscher Fernsehunterhaltung zu sagen gibt.
Interessanter ist da schon, wie Spiegel Online über diesen Artikel berichtet. Der Spiegel und die New York Times betreiben hier nämlich eine eigenartige Spielform des Cross Marketing. Im Spiegel ist zu lesen:
Kulish sieht die Diskussion über die Show als Teil einer größeren Problemlage: Warum hat Deutschland, trotz großer literarischer und filmischer Traditionen, den Anschluß an anspruchsvolle, komplexe Fernsehformate nicht geschafft?
Sieht man sich die entsprechende Textstelle im englischen Original an, ist man doch perplex. Denn die etwas grobschlächtige Analyse deutscher Fernsehkultur stammt gar nicht von Nicholas Kulish, sondern ist wiederum nur ein Spiegel-Zitat:
Der Spiegel asked in its latest issue, “Why are Germans the only ones sleeping through the future of TV?” The magazine called German programs “fainthearted, harmless, placebo television.”
Eine merkwürdige Art des Zirkel-Zitats: Der Spiegel zitiert eine Phrase der New York Times als originär amerikanische Sicht aufs deutsche Fernsehen, die in Wahrheit vom Spiegel selbst stammt. Was bleibt unterm Strich als Fazit: Die New York Times findet das deutsche Fernsehen offenbar nicht wichtig, den Spiegel hingegen schon.