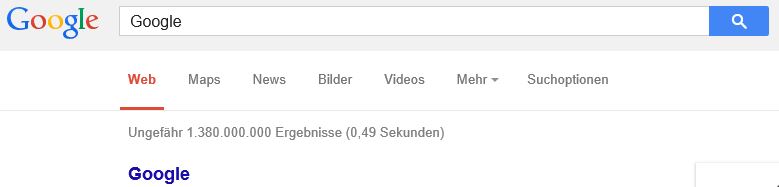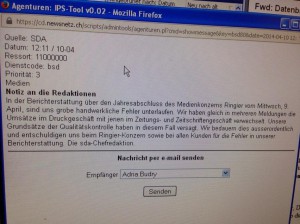Ich bin hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht!
Das geflügelte Wort lenkt das Denken (jedenfalls dort, wo noch gedacht wird) auf den gar nicht selbstverständlichen Umstand, dass wer einen Arbeitsplatz hat, nicht flüchten muss, und umgekehrt wer auf der Flucht ist, zumeist nicht arbeiten darf. Arbeit machen dagegen die Flüchtlinge, und zwar einerseits unseren Politikern und andererseits unseren Journalisten, die das Wirken und Würgen der Politik in Worte verwandeln müssen. Welche Worte sie dafür wählen, hat großen Einfluss auf die Wirkung jenes Würgens und Werkens. Es lohnt sich darum, mal etwas genauer hinzusehen.
Der Kölner Stadtanzeiger hat dazu eine Infografik veröffentlicht, die Zahlen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR illustrieren soll:
Auffällig ist die Angabe, dass von den 19,9 Mio. Menschen, die weltweit im vergangenen Jahr auf der Flucht sich befanden, 31% in Europa Aufnahme gefunden haben sollen – und damit genau so viele wie auf dem afrikanischen Kontinent. Nur wenn man sich die Grafik näher ansieht, stellt man überrascht fest, dass diese Zahl 31% nur zustande kommt, wenn man die Türkei mit zu Europa zählt. Andernfalls wären es nämlich gerade mal 14% der Flüchtlinge, die in Europa Schutz finden – eine erbärmliche Zahl, wobei „erbärmlich“ ja vom „Erbarmen“ kommt, und gerade das lässt Europa in der Flüchtlingsfrage vermissen. Darüber hinaus halten sich die Massen an Flüchtlingen, die die Türkei aufnimmt, natürlich nicht auf dem (sehr kleinen) Teil der Türkei auf, der geographisch auf dem europäischen Kontinent liegt, sondern die allermeisten sind in der Osttürkei nahe der syrischen Grenze, wo diese Flüchtlinge nämlich in der Regel auch her kommen. Andererseits zählen zu Afrika nicht diejenigen Flüchtlinge, die in „Nordafrika“ sind, sonst würde man nämlich auf einen Blick sehen, dass die mit Abstand allermeisten Flüchtlinge, die aus Afrika kommen, ihren eigenen Kontinent niemals verlassen.
Mit solchen irreführenden Zahlenjonglagen wird auch in der Politik argumentiert, wenn eine scheinbare Notwendigkeit von „Ankerzentren“, „Transferzonen“ oder „Sammellagern“ aufgezeigt werden soll oder wenn von „Asyltouristen“ die Rede ist. Hier gibt es nicht nur moralische, sondern auch völkerrechtliche Verpflichtungen, denen gerade die wohlhabenden und prosperierenden Länder der Europäischen Union (EU) sich nicht entziehen können. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) hat in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung darauf hingewiesen, dass man das Elend der Flüchtlinge nicht den Ländern des Trikonts überlassen darf:
„Wenn 500 Millionen Europäer keine fünf Millionen oder mehr verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen können, dann schließen wir am besten den Laden ‚Europa‘ wegen moralischer Insolvenz“.
Allerdings darf an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass besagter Norbert Blüm Regierungsmitglied jener Bundesrepublik Deutschland war, die im Jahr 1992 mit einer abgefeimten Grundgesetzänderung das Recht auf Asyl praktisch abgeschafft und dafür jene „Drittstaaten-Regelung“ eingeführt hat, auf der noch heute die vielzitierte Dublin II-Verordnung der EU basiert. Ein Binnenland wie Deutschland hat sich damit unfein aus der Affäre gezogen, denn es konnte und kann damit quasi nicht mehr in die Lage geraten, dass Asylsuchende oder andere Flüchtlinge an die Tore des Landes klopfen, weil sie ja stets schon einen „Drittstaat“ betreten haben müssen, um an die deutsche Grenze zu gelangen. Schon damals in den 1990er-Jahren war diese Neuregelung niederträchtig und falsch, zumal der Asylartikel ja aufgrund der eigenen Flüchtlings-, Vertreibungs- und Exilgeschichte im Grundgesetz gelandet ist. Heute läuft diese Regelung darauf hinaus, dass eigentlich nur noch drei Länder „legal“ Flüchtlinge aufnehmen müssen, nämlich Italien, Griechenland und Spanien, während die anderen EU-Länder sich auf degoutante Art einen schönen Lenz machen können und sich larmoyant über die „illegalen Migranten“ echauffieren dürfen. Die genannten südeuropäischen Länder werden von der europäischen „Gemeinschaft“ im Stich gelassen, Solidarität ist anders. Wie das ganz praktisch funktionieren soll, hat im übrigen noch kein deutscher oder bayerischer Politiker erklärt: Warum auch, wenn man das Problem so einfach weg-delegieren kann. Dass in Italien aufgrund dieses internationalen Politikversagens postfaschistische und rechtsextremistische Parteien gewählt werden, darf einen nicht allzu sehr verwundern. In Deutschland muss man sie dagegen nicht wählen, wenn man die CSU hat – scheint jedenfalls die schändliche bayerische Logik zu sein.
Was hier insbesondere von bayerischen Regionalpolitikern vorgetragen wird, wenn sie von „Rücknahmeverpflichtungen“ und anderem bürokratischen Neusprech salbadern, entbehrt dabei auch noch der sachlichen Grundlage. Denn die genannten Länder würden ja sogar Flüchtlinge und Asylbewerber von der Bundesrepublik Deutschland „zurück“-nehmen (man kommt ja bei diesem Thema gar nicht darum herum, ständig „Anführungszeichen“ für die Vokabeln aus dem Wörterbuch des Unmenschen zu setzen …), allein Deutschland schickt sie gar nicht. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet unter Verweis auf die Tageszeitung Die Welt:
„Die EU-Partner würden schon jetzt viel mehr solcher ‚Dublin-Fälle‘ zurücknehmen, als Deutschland ihnen überstelle, berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage. So stellte Deutschland 2018 bis Ende Mai in 9233 Fällen solche Übernahmeersuchen an Italien. Das Land stimmte auch 8421 Mal einer Rücknahme zu – überstellt wurden aber nur 1384. Sicherheitsbehörden gäben als Hauptgrund an, dass die Migranten am Rückführungstermin nicht angetroffen würden. Ähnlich sei das Verhältnis bei Spanien: Bei 1849 Übernahmeersuchen stimmte das Land 1255 Mal zu – überstellt wurden 172 Migranten“.
Viel Lärm um nichts? Das kann man nicht sagen, denn es geht nicht um „nichts“. Es geht vielmehr um beinahe „alles“, jedenfalls wenn man Moralität und Gerechtigkeit noch einen Totalitätsanspruch zubilligt.